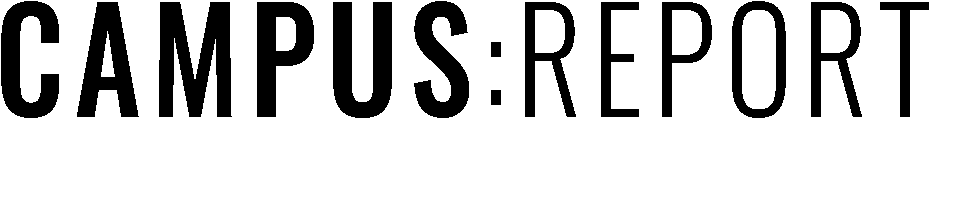Die Nächste, bitte!
Medizin ist männlich – noch.
Das Bild sorgte in den sozialen Medien für Furore: eine anatomische Abbildung eines menschlichen Oberkörpers mit Knochen, Muskeln, Sehnen, Fettgewebe und … Was sollte denn das sein? Zehntausenden, die sich das anschauten, wurde schlagartig klar, dass sie noch niemals Milchdrüsen gesehen hatten, obwohl rund 50 Prozent der Weltbevölkerung sie besitzen.
„Gendermedizin?! Diese Einteilung ist viel zu grob.“
„Ach, Sie berücksichtigen schon den
Hormonspiegel?“
Stille.
Kurze Dialoge dieser Art hat Professorin Anke Hinney in den vergangenen Jahren mit so einigen Kolleg*innen geführt. „Geschlechtssensible Medizin, wie ich es lieber nenne“, erklärt die Molekulargenetikerin, „berücksichtigt in der Forschung, Prävention und Therapie Unterschiede in den Geschlechtern. Und zwar in biologischer, aber auch in soziologischer Hinsicht.“
Der nicht so kleine Unterschied
Wer das für überflüssig hält, sollte sich kurz erinnern, welche Symptome auf einen Herzinfarkt hindeuten können. Schmerzen im linken Brustbereich, die eventuell in den Arm ausstrahlen? Atemnot? Beklemmung? Stimmt alles – trifft jedoch oft nicht auf Frauen zu. Die Symptome sind hier mitunter weniger eindeutig, zum Beispiel Rückenschmerzen oder Übelkeit. Und obwohl jede Minute zählt, sind betroffene Frauen im Schnitt eine ganze Stunde später im Krankenhaus als Männer mit der gleichen Diagnose. „Mögliche geschlechtsspezifische Unterschiede von Krankheiten und ihren Symptomen nicht zu kennen, kann so in manchen Fällen lebensbedrohlich sein.“ Für Hinney war das eine Motivation, in diesem Jahr mit dafür zu sorgen, dass Gendermedizin als Wahlfach für Medizinstudierende angeboten wird.
Bis vor wenigen Jahren wurden Medikamentenstudien nur mit Männern durchgeführt.
Die Schulmedizin, die das Männliche zur Norm erhoben hat, hat ihren Ursprung vermutlich an zwei Stellen: Da sind zum einen die Mediziner selbst, die viele Jahrhunderte lang nur Herr Doktor waren. Zum anderen sind da die Medikamentenstudien. Sie wurden bis vor wenigen Jahren ausschließlich mit Männern durchgeführt. Denn eine Schwangerschaft und mögliche Folgeschäden für das Kind lassen sich so am leichtesten ausschließen. Und auch hormonelle Schwankungen grätschen der Studie nicht in die Daten. Doch damit gelten die Dosierungsempfehlungen des kräftigen Probanden zwangsläufig auch für die zierliche Patientin. Mittlerweile müssen Medikamentenstudien jedoch an Männern und Frauen durchgeführt werden, ansonsten werden sie auch nur für ein Geschlecht zugelassen – zu intersexuellen Personen gibt es keine Richtlinie.
Personalisierte Medizin
Gendermedizin ist mitnichten Frauenmedizin: Depressionen, Osteoporose oder Essstörungen stehen natürlich im Ruf, typisch weibliche Krankheiten zu sein. Spielen bei dem oder der Behandelnden dann noch (un)bewusste Rollenbilder hinein, bleibt die Osteoporose des männlichen Patienten leicht unerkannt. Und obwohl sich in Deutschland dreimal mehr Männer als Frauen selbst töten, läuft der depressive Mann Gefahr, als Autist diagnostiziert zu werden.
„Gendersensible Medizin ist nur der nächste logische Schritt hin zur individualisierten Medizin“, so Hinney. Denn das biologische und soziologische Geschlecht beeinflussen unsere Berufswahl, Ess- und Genussverhalten, unsere Risikobereitschaft und den Umgang mit Erkrankungen. „All das sollte ein guter Arzt oder eine gute Ärztin mitdenken“, findet sie.
Heulsuse und tapferer Krieger
Medizinische Lehrbücher, eigentlich prädestiniert für nüchterne Faktendarstellungen, sind auch im Jahr 2020 noch immer klischeebehaftet, muss Professor Sven Benson feststellen: „Da liest man in den Fallbeispielen regelmäßig vom männlichen Herzinfarktpatienten, der sich kaputtgeschuftet hat. Demgegenüber steht die chronische Schmerzpatientin, die nicht wirklich was hat“, so der Experte für Schmerzforschung.
Tatsächlich zeigen Studien, dass Frauen häufiger von chronischen Schmerzen betroffen sind. Doch hier kommen die soziologischen Aspekte der Gendermedizin ins Spiel: Ist das wirklich eine körperliche Tatsache? Oder gehen Frauen mit Schmerzen anders um? Sprechen offener darüber, gehen schneller zum Arzt? Es gibt Hinweise darauf, dass die Schmerztoleranz von Männern höher ist. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte eine tradierte geschlechterspezifische Erziehung sein: „Ein in der Kindheit oft gehörtes Du bist ja ein Mädchen, wenn du weinst oder das klassische Ein Indianer kennt keinen Schmerz prägen zum Teil ein Leben lang“, weiß Benson.
Attraktivität beeinflusst
Spielt man ein wenig mit Klischees und Erwartungen, kann sich auf einmal ein anderes Bild ergeben: Eine Studie, bei der Versuchspersonen ihre Hand so lange wie möglich in eiskaltes Wasser halten sollten, bestätigt die höhere Schmerztoleranz von Männern. „Doch sagt man den Teilnehmenden vorher, dass Männer und Frauen in der Regel gleich lang durchhalten, dann tun sie das anschließend auch“, berichtet Benson. Ach ja: Wie tapfer jemand ist, hängt auch noch ab von der Person, die den Versuch leitet. Genauer: von ihrem Geschlecht und ihrer Attraktivität. Dass das Gegenüber einen Einfluss hat, ist nicht neu. So weiß man: Die Beziehung zwischen Ärzt*in und Patient*in entscheidet mit über den Erfolg einer Therapie.
Zurück zum Anfang: Das Anatomiebild aus dem letzten Jahr hat Aufsehen erregt, zur Standarddarstellung für den menschlichen Körper ist es (noch) nicht geworden. Wer es nicht gesehen hat: Die Milchdrüsenlappen der weiblichen Brust sind angeordnet wie Blütenblätter.
Blaues Auge und dennoch ein Lächeln auf den Lippen - so ein Schauspieler! Richtig. Der tapfere Mann ist ein Simulationspatient, an dem Medizinstudierende ihre Kenntnisse testen. Er wurde geschminkt. Foto: Frank Preuß