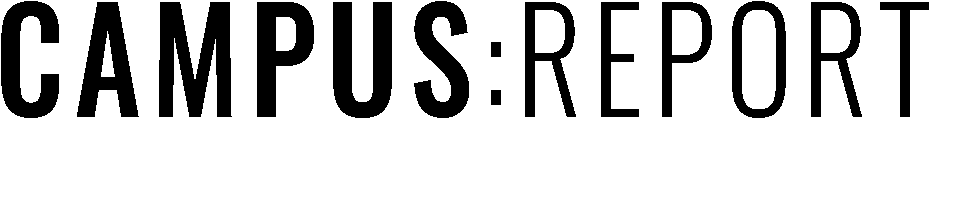Das Kreuz mit dem Sternchen
Wie gender darf unsere Sprache sein? Für Linguistin Carolin Müller-Spitzer ist die Antwort klar.
„Liebe MitgliederInnen …“ begann die Rund-Mail, und während man rätselte, ob der Verfasser (namentlich ein Mann) es mit dem Gendern nur versehentlich übertrieben hatte, gab es schon den ersten Kommentar: „Muss das sein?“, ein zweiter erinnerte: „Das Binnen-I hat ausgedient!“
Tatsächlich erhitzen jetzt kleine Zeichen die Gemüter. Seit Bürger*innen wählen gehen, das Land Lehrer_innen sucht oder Polizist:innen im Einsatz sind, seit also Sternchen, Doppelpunkt und Unterstrich unsere Sprache erobern, wird heftig gestritten. Ist das Gaga oder Unfug, wie die einen polemisieren, oder ein Muss, will man sprachlichen Sexismus beenden – darauf beharren die anderen. Auch die maßgebenden Fachverbände und Linguist*innen helfen nicht, den Konflikt oder zumindest Grammatikfragen zu lösen, die beim genderneutralen Formulieren auftauchen. Man ist in der Sache uneins bis unversöhnlich oder will sich noch nicht festlegen.
Der Mann als Norm
Carolin Müller-Spitzer gehört zu denen, die gerne mit den neuen Formen experimentieren. Sie kann erklären, warum es im Deutschen drei Genera gibt, nach welchen Regeln Nomen zu der, die oder das werden, aber auch, warum Sternchen und Co. keinesfalls nervig sind. „Lange Zeit“, sagt die Professorin für Germanistische Linguistik, „bildete der Mann die Norm, Frauen spielten im öffentlichen Raum keine Rolle, was sich in die Sprache einschrieb. Heute passt die gesellschaftliche Wirklichkeit oft nicht mehr zum traditionellen Sprachgebrauch.“
Zwar will das generische Maskulinum – also Lehrer, Bürger, Polizisten, um in den obigen Beispielen zu bleiben – alle Geschlechter mitdenken. Etliche Forschungen belegen aber, dass solche Personenbezeichnungen häufig keineswegs neutral verstanden werden; vielmehr entstehen männliche Bilder. „Sprache prägt Denkmuster“, betont Müller-Spitzer und findet den Vorwurf, Gendersprech sei Sprachdiktatur, völlig überzogen. Und: „Wurde andersherum nicht permanent die männliche Form aufgezwungen?“
Unaussprechlich: Bürger:innen-Meister:in
Vorschreiben möchte sie niemand, wie geredet werden soll. Jedenfalls nicht in privaten Bezügen. Da kann man wir Nachbarn sagen und das lesbische Pärchen von nebenan mitmeinen oder sogar von Mensch*in und Gäst:in sprechen, auch wenn Müller-Spitzer es für völlig überflüssig hält, epizöne Begriffe, also ohnehin neutrale, noch gendern zu wollen.
In beruflichen und institutionellen Kontexten sieht sie hingegen eine andere Verantwortung. Wird Sprache sozusagen öffentlich, „sind Richtlinien wichtig, um als Institution einheitlich zu wirken“. So hat sie Verständnis dafür, dass immer mehr Firmen, Einrichtungen, aber auch Medien versuchen, sich diskriminierungsfrei auszudrücken. Wenn nun Amtsdeutsch, Radiosendungen, Schulbücher und Geschäftsberichte geschlechtersensibler getextet werden: Was ist mit schöngeistiger Literatur? Hier, findet die Expertin, sei die Entscheidung den Autor*innen selbst überlassen.
Holprig, sperrig … neu
Sprache lebt vom Klang, vom Lesefluss, von der Verständlichkeit. Blähen die kleinen Zeichen Sätze nicht unnötig auf und machen sie holprig? Beispiel: Das Seminar richtet sich an Techniker:innen und Informatiker:innen und ist auch für Anfänger:innen geeignet. Soll man nicht mehr sagen: Ich gehe zum Bäcker, wo doch das Geschäft, nicht die Person gemeint ist? Ist es nicht alltagsfern (und grammatisch falsch) zu rufen: Wir brauchen eine*n Ärzt*in! Werden Wortkonstrukte wie Bürger:innen-Meister:in nicht zurecht als monströs und unaussprechlich abgelehnt? Und überhaupt: Wie rede ich das 3. Geschlecht an? Sehr geehrte Damen, Herren und Diverse …? Oder einfach: Liebe Mitmenschen …?
Carolin Müller Spitzer (45) ist Professorin für Germanistische Linguistik und vertritt zurzeit einen Lehrstuhl an der UDE. Sie forscht und lehrt sonst an der Uni Mannheim und leitet außerdem den Bereich „Lexik empirisch und digital“ am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. Ihre Schwerpunkte sind u.a. die Genderlinguistik und der Wortschatzwandel.
Sie selbst nutzt bei Pluralformen das Gendersternchen und versucht, im Singular neutrale Bezeichnungen zu finden oder Formen abzuwechseln.

Müller-Spitzer kennt all diese Einwände und Beispiele. Ja, Gap, Sternchen, Doppelpunkt im Alltag zu gebrauchen, sei erst einmal ungewohnt und zuweilen kompliziert. Nein, es gebe noch nicht für alles praktikable Regelungen, „denn es ist ein längerer Lernprozess. Diejenigen, die sich professionell mit Sprache beschäftigen, sind dazu aufgerufen, an vielfältigen, offenen Lösungen zu arbeiten, Forschung zu befördern und mit nachzudenken.“ Noch sei nicht abzusehen, was sich durchsetze. Vielleicht entstünden auch ganz neue generische Ausdrücke.
Warum nicht? Wortschöpfungen hat es in der Sprachgeschichte schon immer gegeben, man denke nur an die vielen Anglizismen und auch an aufgeweichte Grammatikregeln. Allein, dass über das Gendern diskutiert werde, deute auf Sprachwandel hin, sagt Carolin Müller-Spitzer. „Leider ist es schwer, eine sachliche Diskussion zu führen.“ Die einen sehen Sterne, die anderen rot.
Raucherhusten, Redepult
Findet sie Genderdeutsch ästhetisch? „Geschlechtergerechtes Schreiben und schönes Schreiben schließen sich nicht aus, aber eine Herausforderung ist das Genus-System des Deutschen schon“, gibt die Sprachexpertin zu. „Vor allem bei Singularformen. Der*die behandelnde Arzt*Ärztin ist sicher alles andere als elegant, aber oft findet man auch Umschreibungen, wie Person, die die ärztliche Behandlung durchführt.“ Oder man wechselt Formen ab (fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Apotheker). Viele Kompositionen lassen sich leicht verändern (Redepult, Teilnahmeliste), andere hingegen nicht (Raucherhusten, Beamtenlaufbahn). Müller-Spitzer rät, kreativ mit Sprache umzugehen und auszuprobieren, aber: „Für manches gibt es keine gute Lösung, da sollte man es beim Alten belassen.“
Geschlechtersensible Texte seien sehr wohl verständlich und lesbar – das zeigten empirische Studien. Und die Genderzeichen auszusprechen, „funktioniert viel besser, als viele meinen, zum Beispiel wird es selbst im heute-journal mittlerweile praktiziert. Den so genannten glottalen Verschlusslaut, der dafür genutzt wird, kennen wir von Worten wie ide-al oder aktu-ell.“
Die Linguistin wünscht sich weniger schrille Töne in der ganzen Sache. „Sprache gehört allen, die sprechen und schreiben, und alle, die Sprache nutzen, verändern sie mit.“ Wie lange wird es dauern, bis das Experiment (bzw. der Wertekonflikt) beendet ist – eine Generation? „Mal sehen, was in 10 bis 20 Jahren für uns sprachliche Normalität sein wird. Es ist auf jeden Fall erstaunlich, welche Dynamik das Thema gerade in den letzten zwei Jahren durch die Me-Too-Debatte erfahren hat; die Diskussionen um gendergerechte Sprache gibt es schließlich schon sehr viel länger.“
Vielleicht braucht es auch eine noch gewagtere Lösung, eine, die die amtliche Rechtschreibung völlig auf den Kopf stellt. Denn auch diese Forderung gibt es: Schafft das Genus komplett ab!
Karikatur: nelcartoons.de