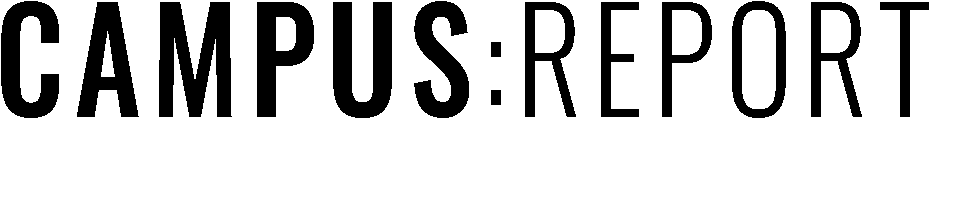Leben in der Badewanne
Krebs und Fisch schwitzen nicht, aber auch sie leiden, wenn ihr Bach zu warm ist oder ihr Weiher drastisch schrumpft. Ist der Klimawandel schon in NRW-Gewässern angekommen?
Von Birte Vierjahn
Gerade einmal 150 Jahre ist es her, da waren Teile des heutigen Ruhrpotts Malaria-Gebiet.. „Durch die Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts wurden enorme Mengen warmer Abwässer in die Emscher geleitet“, erklärt Professor Dr. Daniel Hering. Parasit und übertragende Mücken genossen die Wärme und vermehrten sich in der Flussumgebung ungeniert.
So verheerend sieht die Lage der Gewässer in NRW heute nicht mehr aus, aber dennoch: „Der heiße Sommer 2018 war ein echter Cut“, berichtet der Professor für Angewandte Hydrobiologie. „Die Leistung von Kraftwerken musste sogar reduziert werden, weil deren Kühlwasser die Flüsse über die Grenzwerte hinaus erhitzt hätte“. Dennoch verendeten sehr viele Fische in diesem Sommer.
Gemeinsam mit seinem Kollegen Bernd Sures leitet Hering die Arbeitsgruppe „Aquatische Ökologie“. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie sich verschiedene Belastungen auf Gewässer und deren Bewohner auswirken: Einzeller, Pflanzen, Tiere. Der Klimawandel ist dabei nur ein Aspekt ihrer Forschung, aber er lässt sich auch nicht übersehen – womit wir wieder beim Sommer 2018 sind: Erstmals sind fast alle kleinen Gewässer im Emschergebiet und im Arnsberger Wald, die von den Wissenschaftler*innen regelmäßig untersucht werden, trockengefallen.
Die anspruchsloseren Arten sind noch da. Viele andere sind verschwunden.
Mit entsprechenden Konsequenzen für die hier lebende Fauna. Die anspruchsloseren Arten, die trockengefallene Gewässer schnell wiederbesiedeln, wie manche Eintagsfliegen, sind noch da. Viele andere sind verschwunden. Ob unwiederbringlich, das lässt sich erst in etwa zehn Jahren sagen. „Es ist aber wahrscheinlich, dass Arten zunehmen, die nicht das ganze Jahr hinweg auf Wasser angewiesen sind, die viele Nachkommen haben und Hitze gut tolerieren“, vermutet der Biologe aus Erfahrung. Das sind vor allem bestimmte Insektenarten wie manche Eintagsfliegen, Käfer oder Wanzen.

Atemnot unter Wasser
Auf zwei Arten kann die Erderwärmung Gewässer beeinflussen: über Veränderungen des Abflusses sowie der Wassertemperatur. Alles andere, was Pflanzen und Tieren das Leben schwermacht, ist eine direkte Folge daraus. Denn warmes Wasser kann weniger Sauerstoff binden. Gerade bei hohen Temperaturen sind die meist wechselwarmen Wassertiere aber besonders aktiv und atmen daher mehr. Fehlt dann noch ein munter über Steine plätschernder Zufluss, der Blasen im Wasser wirft, ist das Schicksal von Bachforelle und Teichnapfschnecke besiegelt – in einer Badewanne überlebt niemand lange.
Dass vom Austrocknen vor allem Bäche und kleine Weiher bedroht sind, ist logisch. Aber tatsächlich sind die großen Flüsse wie Rhein, Weser oder Ems deutlich schneller zu warm als ihre kleinen Cousins.
Das liegt daran, dass Bäche und Rinnsale in der Regel vom Grundwasser gespeist werden, und das ist bei uns recht konstant 7 bis 8°C kalt. Flüsse haben dagegen großflächig Kontakt zur Luft, und die kühle Quelle ist weit weg – langanhaltender Hitze haben sie daher kaum etwas entgegenzusetzen. „Es ist die Summe aller Belastungen, die entscheidet“, so Hering. „Effekte des Klimawandels machen sich natürlich schneller bemerkbar bei Gewässern, die durch Dünger, warme oder verschmutzte Abwässer und Acker-Erosion ohnehin schon leiden.“ Direkt am Ufer eines Baches darf ein Landwirt in NRW übrigens schon heute nur noch eingeschränkt Pflanzenschutzmittel und Dünger aufbringen. „Ein Streifen mit naturbelassenem Bewuchs zwischen Acker und Gewässer wäre ein richtiger und wichtiger Schritt. Aber das nimmt dem Landwirt Anbaufläche, daher ist es natürlich schwierig durchzusetzen.“
Manchmal ist die Schattenseite die bessere
Noch beschränken sich die bemerkbaren Effekte des Klimawandels vor allem auf die kleineren Gewässer wie diejenigen im Arnsberger Wald, meint der 54-Jährige. Und glücklicherweise ist der Therapievorschlag für das Symptom „Überhitzung“ zumindest bei kleinen Gewässern so simpel wie effektiv: Beschattung. Rund 5°C Unterschied zeigt das Thermometer seiner Studierenden zur heißesten Sommerzeit am gleichen Bach zwischen einem schattigen Plätzchen und einem sonnenbeschienenen Abschnitt zwei Kilometer weiter. „Da wären wir wieder beim Streifen Wildwiese“, setzt Hering nach. „Lässt man der Natur ihren Lauf, sind schon nach fünf Jahren erste Bäume groß genug, um einen Bach zu beschatten.“ Die Theorie steht also, die Praxis ist leider noch ein Keimling.
„In den 1970ern war der Rhein nahezu tot.
Heute sind 99 Prozent der dort lebenden Kleintiere eingewandert.“
Um den Zustand eines Baches oder Sees objektiv beurteilen zu können, führt Herings Arbeitsgruppe Langzeitstudien durch. Dafür sammelt sie dort einmal jährlich kleine Lebewesen wie Krebstiere, Larven und Muscheln. Da jede Art bestimmte Grundvoraussetzungen braucht, lässt sich die Wassergüte darüber definieren, welche Tiere sich in den Keschern und Gläsern finden lassen oder eben fehlen. Um Vorhersagen für die Zukunft abzuleiten, werden die Wasserbewohner auch im Labor unter genau definierten Bedingungen untersucht: Wie reagiert eine Kugelmuschel auf wärmeres Wasser? Und wie verhält sich die Larve der Köcherfliege, wenn sich der Sauerstoffgehalt verändert?
Nur neue Mieter im Rhein
Auf die harte Tour mussten das übrigens in den 1970er-Jahren die Tiere im Rhein erfahren: „Der Fluss war damals so verschmutzt, er war nahezu tot“, erinnert sich Hering. Fast alle einheimischen Wasserbewohner verschwanden. Als der Zustand sich wieder besserte, freuten sich andere über das praktisch konkurrenzlose Revier. „99 Prozent der heute dort lebenden Kleintiere sind eingewandert.“ Doch nachdem sie vor 50 Jahren ein vermeintliches Paradies gefunden haben, sind die Lebensbedingungen künftig alles andere als himmlisch, das Ende noch offen. Wie Mark Twain sagte: „Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich.“
Fotos: AG Aquatische Ökologie / Jörg Vieli auf Pixabay