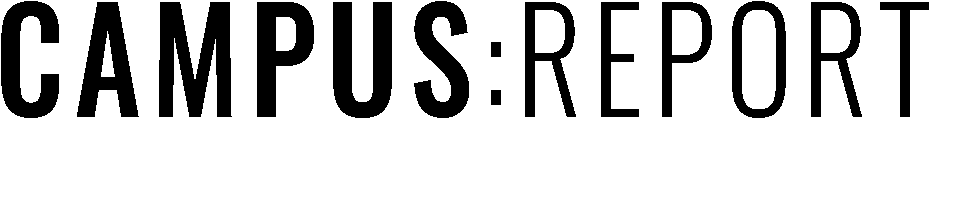Stadtgesundheit
Verändert sich das Klima, braucht es einen starken Körper. Wie eine Stadt dazu beitragen kann, erforscht Professorin Susanne Moebus.
Von Cathrin Becker
Klimawandel, Klimawandel, Klimawandel. Susanne Moebus kann es nicht mehr hören. „Ja sicher, er wird kommen.“ Doch in der Diskussion darüber vermisst die Biologin ein Argument besonders: „Wir haben schon sehr viel Wissen und Erfahrung, wie wir mit Hitze oder Infektionen umgehen können. Aber was wir nicht haben, um uns vorzubereiten und gesund zu bleiben, ist mehr soziale Gleichheit.“
Moebus teilt ihr Büro mit vielen Pflanzen. Die Farbe an der Wand, ein Sitzsack in der Ecke, beides grün. Den Klimawandel erforscht sie nicht direkt, stellt sie im Gespräch klar, aber er schwinge beim Thema Nachhaltigkeit und Gesundheit immer mit. Einen Punkt erwähnt sie gleich öfter: Es müsse immer erst etwas eintreten, bevor sich gekümmert werde. Das ärgere sie. Der Klimawandel sei da keine Ausnahme, ebenso wenig Krankheiten. „Wenn es darum geht, die Gesundheit zu erhalten, fehlt die Lobby.“ International gebe es den Public Health-Begriff, also öffentliche Gesundheit. Die förderte man auch lange in Deutschland, bis sie im Dritten Reich missbraucht wurde. Bei Krankheiten wird heute viel getan, für die Gesundheit zu wenig – fatal, wenn die Auswirkungen des Klimawandels spürbar werden, findet Moebus, vor allem für die Kranken, Schwachen und Armen.
Klar, es gibt vorbeugende Maßnahmen wie Grippeschutz, Entspannungsprogramme oder Sport. Doch um den Körper vorzubereiten und fit zu halten, braucht es ein entsprechendes Umfeld, sagt die Leiterin des Zentrums für urbane Epidemiologie am Uniklinikum. Früher beschäftigte sie sich in ihrer Forschung mit Krankheiten, heute interessiert sie, was Menschen gesund hält.

Susanne Moebus
Die Professorin ist Biologin und Epidemiologin und seit 1996 am UK Essen. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Sozialmedizin und Prävention. Selbst fit hält sie sich mit Radfahren, Boxgymnasting und Gartenarbeit.
Gesundheit ist Privatsache
Vieles ist Privatsache und eine Frage der Chancengleichheit: Wer selbst dafür Sorge trägt, dass er sich gut ernährt und bewegt, wird häufig von der Krankenkasse belohnt. Aber was, wenn Angebote und Möglichkeiten fehlen oder nicht passen? Pech! „Indem die Krankheitsrisiken individualisiert werden, bekommen die Betroffenen die Schuld zugeschoben. Dadurch wird schnell vernachlässigt, die Verhältnisse zu verbessern, wie z.B. die Umweltbedingungen oder Bildungschancen.“
Natürlich müssen auch die Menschen was tun – und doch verpuffen seit Jahrzehnten die Appelle, Bewegung in den Alltag zu integrieren oder sich bewusster zu ernähren. Die sogenannten Volkskrankheiten und Übergewicht sind noch längst nicht im Griff. „Wir müssen es daher allen leichter machen, sich zu ändern.“ Was dabei auf jeden Fall helfe, sind die städtebaulichen Strukturen und die Gestaltung der Stadt. Das ist Moebus‘ Thema.
Wie sieht eine Stadt fürs gesunde Leben aus?
Aufs Grün kommt es an. Viel davon in der direkten Wohnumgebung ist gesundheitsförderlich. Damit jeder was davon hat, müssen die Wege und der öffentliche Nahverkehr zu Parks einfach gestaltet und sicher für jeden zu betreten sein. „Wir erforschen auch, wie fahrradfreundlich die Stadt gebaut ist oder welche Geschäfte es in der Nachbarschaft gibt. Kann man die Einkäufe, den Wege zur Arbeit, Schule oder Kindergarten zu Fuß oder per Rad zurücklegen und das gerne?“ Wenn sich Burgerladen, Döner- und Pommesbude aneinanderreihen, statt Gemüse- und Obststände, wird es schon schwieriger mit den gesunden Angeboten, selbst wenn man sie nutzen will. „Hierfür sind die Daten der von meinen Kollegen Jöckel und Erbel geleiteten Heinz Nixdorf Recall Studie ein ungemein wertvoller Datenschatz.“ Seit 15 Jahren wird hierbei die Gesundheit von 4.500 Menschen im Ruhrgebiet untersucht.
Clever Cities: Wie Städte gestaltet sein müssen, welche Wirkung Nachbarschaften, Gebäude und Infrastruktur haben und wie Bewohner*innen bei der Problemfindung und der Umgestaltung helfen können, untersucht Moebus in ihrem EU Projekt Clever Cities. Alle städtischen Umweltprobleme wird es nicht lösen können, aber Änderungen bewirken. „Wir wollen gemeinsam nach Lösungen aus der Natur suchen.“
Die Umwelt und die Gesundheit von Menschen interessieren die Wissenschaftlerin schon lange. Ursprünglich wollte sie Medizinerin werden, als das nicht klappte, studierte sie Biologie an der Uni Bremen, später Gesundheitswissenschaften / Public Health in Bielefeld.
Susanne Moebus scheut sich nicht vor sperrigen Meinungen und Projekten. Sie gibt freimütig zu, wie schwierig ihr Weg zum ersten unbefristeten Vertrag war – er kam mit ihrer Professur 2008 – und wie mühselig es ist, ihre Forschungsthemen durchzukriegen. „Wir arbeiten interdisziplinär, auch transdisziplinär, also mit gesellschaftlichen Akteuren. Die Anträge klingen durchaus auch sexy, aber sie sind schwieriger zu verkaufen, weil die Geldgeber immer noch sehr fachgebunden denken. Wir könnten mit unserer Forschung zwar viele Erkenntnisse gewinnen, aber sie ist einfach noch nicht anerkannt genug.“
Soundscapes
Akustische Qualität in der Stadt ist momentan das Lieblingsprojekt der 61-Jährigen – und schnell bewilligt worden. Motorbrummen, Musik aus dem Café, Vogelgezwitscher, Gesprächsfetzen: Jede Stadt klingt anders. Wie diese Geräuschkulisse, diese Soundscapes, unabhängig vom Lärmpegel die Gesundheit der Städter beeinflusst, will sie am Beispiel von Bochum herausfinden. „Tolle Kooperation mit der TU Dortmund, tolles Team“, schwärmt Moebus. Vor allem gehe es um die Frage, was jenseits der Qualität „leise“ gut für das Wohlbefinden ist.
Außerdem will das Team wissen, wie Städte so gestalten werden können, dass wir gerne und gesund dort leben, auch wenn alles enger und wahrscheinlich dadurch lauter wird. Die ersten Ergebnisse sind gut. „Diejenigen, die sich mit Lärm beschäftigen, verwenden nur den so genannten Druckpegel, aber keiner berücksichtigt das ganze Frequenz-Spektrum, um daraus weitere Indizes zu bilden. Wir haben jetzt einen Datensatz, den es so weltweit noch nicht gibt.“
Das gefällt Susanne Moebus, doch sie hat größere Pläne: In den nächsten fünf Jahren träumt sie davon ein Public Health-Institut für kommunale/urbane Gesundheit aufzubauen und es ihrem Team zu hinterlassen. „Auch mit Blick auf den Klimawandel wird der Forschungsbedarf in diesem Bereich größer werden. Ich hoffe, das klappt!“
Fotos: Foto: picture alliance/Bildagentur-online/AGF-Chapeaux (links) / Frank Preuß